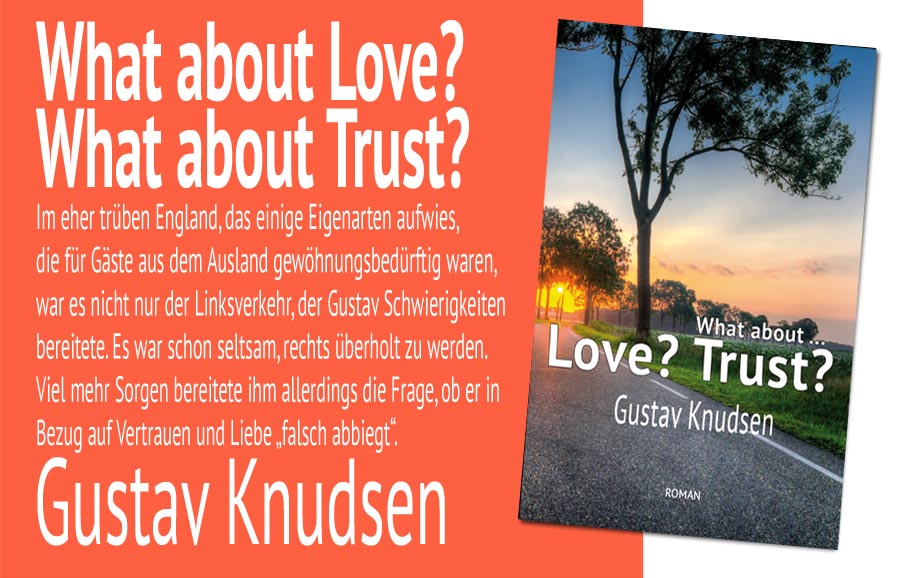Die Zwerg- und Riesensäugetiere der Inseln sind am ehesten vom Aussterben bedroht. Dies geht aus einer internationalen Studie hervor, die unter Beteiligung des Mittelmeer-Instituts für Höhere Studien (Imedea, CSIC-UIB) in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde. In einer Pressemitteilung berichtet die Universität der Balearen (UIB), dass eine kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift veröffentlichte Studie zeigt, dass Inselarten, die bei ihrer Entwicklung eine extremere Körpergröße als ihre Verwandten auf dem Festland angenommen haben, stärker vom Aussterben bedroht sind als solche, die diese Entwicklung nicht durchgemacht haben. Darüber hinaus stieg die Gesamtaussterberate von Inselsäugetieren nach der Ankunft des modernen Menschen deutlich an.
An der Studie, die von Forschern des deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) geleitet wird, sind Forscher verschiedener internationaler Organisationen beteiligt, darunter auch der spanische Nationale Forschungsrat über zwei Forschungszentren, die Biologische Station Doñana und Imedea (CSIC-UIB).
Extreme Veränderungen der Körpergröße sind als Gigantismus und Zwergwuchs bekannt. Im Allgemeinen schrumpfen auf Inseln die Verwandten der großen kontinentalen Arten, während die kleinen Arten eher wachsen.
Beispiele für diese Prozesse sind ausgestorbene evolutionäre Wunderwerke wie Mammuts und Zwergflusspferde, die auf weniger als ein Zehntel der Größe ihrer kontinentalen Vorfahren anwuchsen, sowie atypisch große Nagetiere und Gymnospermen, die auf mehr als das Hundertfache ihrer ursprünglichen Größe anwuchsen. Zu diesen Arten gehören auch Zwerge und Riesen, die heute vom Aussterben bedroht sind, wie der Mindoro-Wasserbüffel (Bubalus mindorensis), ein Zwergbüffel mit einer Schulterhöhe von etwa 100 Zentimetern, und das Jamaikakaninchen (Geocapromys brownii), ein rattenähnliches Säugetier, das etwa so groß wie ein Kaninchen ist.
Die Studie bestätigt, dass die Evolution zu diesen Merkmalen oft mit einer erhöhten Anfälligkeit für das Aussterben einhergeht. „Einerseits bieten phylogenetische Giganten eine größere Belohnung für Raubtiere“, erklärt der Erstautor Dr. Roberto Rozzi. „Andererseits scheinen Zwergarten weniger widerstandsfähig zu sein, so dass sie leichter von eingeführten Raubtieren gejagt oder bejagt werden können.
Um zu quantifizieren, wie sich die Entwicklung hin zu Zwergwuchs und Gigantismus auf das Aussterberisiko und die Aussterberate – vor und nach der Ankunft des Menschen – ausgewirkt haben könnte, verwendeten die Forscher Daten von fossilen und lebenden Inselsäugetieren von mehr als 1.200 ausgestorbenen und 350 ausgestorbenen Inselsäugetierarten von 182 Inseln und Paläoinseln – Landmassen, die einst isoliert waren und heute Teil von Kontinentalgebieten sind – auf der ganzen Welt.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Arten, die die extremsten Veränderungen in der Körpergröße erfahren haben – entweder größer oder kleiner – am ehesten auf Inseln ausgestorben oder gefährdet sind. Ein Vergleich zwischen den beiden Richtungen der Körpergrößenveränderung zeigte, dass Riesenarten auf Inseln ein etwas höheres Aussterberisiko haben als Zwergarten auf Inseln. Dieser Unterschied war jedoch nur dann signifikant, wenn die ausgestorbenen Arten einbezogen wurden.
Seit der europäischen Expansion um die Welt sind sowohl Zwerg- als auch Riesensäugetiere in ähnlicher Weise vom Aussterben betroffen. „Dies ist wahrscheinlich das Ergebnis der Auswirkungen der intensivsten und vielseitigsten menschlichen Einflüsse, wie Raubbau und beschleunigter Lebensraumverlust, aber auch die Einführung neuer Krankheiten und invasiver Raubtiere“, sagt Dr. Roberto Rozzi. Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) bezeichnet Inseln als einen Schwerpunkt des Artensterbens, da 50 Prozent der bedrohten Arten Inselarten sind.
Die Forscher analysierten auch die globalen Fossilien von Säugetieren auf Inseln in den letzten 23 Millionen Jahren – dem späten Känozoikum – und fanden eine klare Korrelation zwischen dem weltweiten Aussterben von Inseln und der Ankunft des modernen Menschen.
„Wir verzeichnen eine abrupte Verschiebung im Aussterberegime der Ökosysteme vor dem Sapien im Vergleich zu den von Sapien dominierten Inselökosystemen. Die zeitliche Überschneidung der Inselsäugetiere mit dem Homo sapiens erhöhte die Aussterberaten um mehr als das 10-fache. Unsere Gesamtergebnisse schließen jedoch nicht aus, dass auch Umweltfaktoren wie der Klimawandel zum Aussterben von Inselsäugetieren auf lokaler Ebene beigetragen haben“, erklärt der Hauptautor der Studie, Professor Jonathan Chase vom iDiv und der MLU.
„Es ist zwar wichtig, mehr paläontologische Felddaten zu sammeln, um die Chronologie des Aussterbens weiter zu verfeinern, aber gleichzeitig sollte der Schutz der extremeren Inselriesen und -zwerge, von denen viele bereits vom Aussterben bedroht sind, in der Naturschutzagenda besondere Priorität erhalten.“ „Leider sind im Mittelmeerraum und auf den Kanarischen Inseln bereits alle Säugetiere verschwunden, die spektakuläre Größenveränderungen aufwiesen, und die Erhaltung der wenigen überlebenden endemischen Arten muss jetzt Priorität haben“, so Josep Antoni Alcover.
Quelle: Agenturen