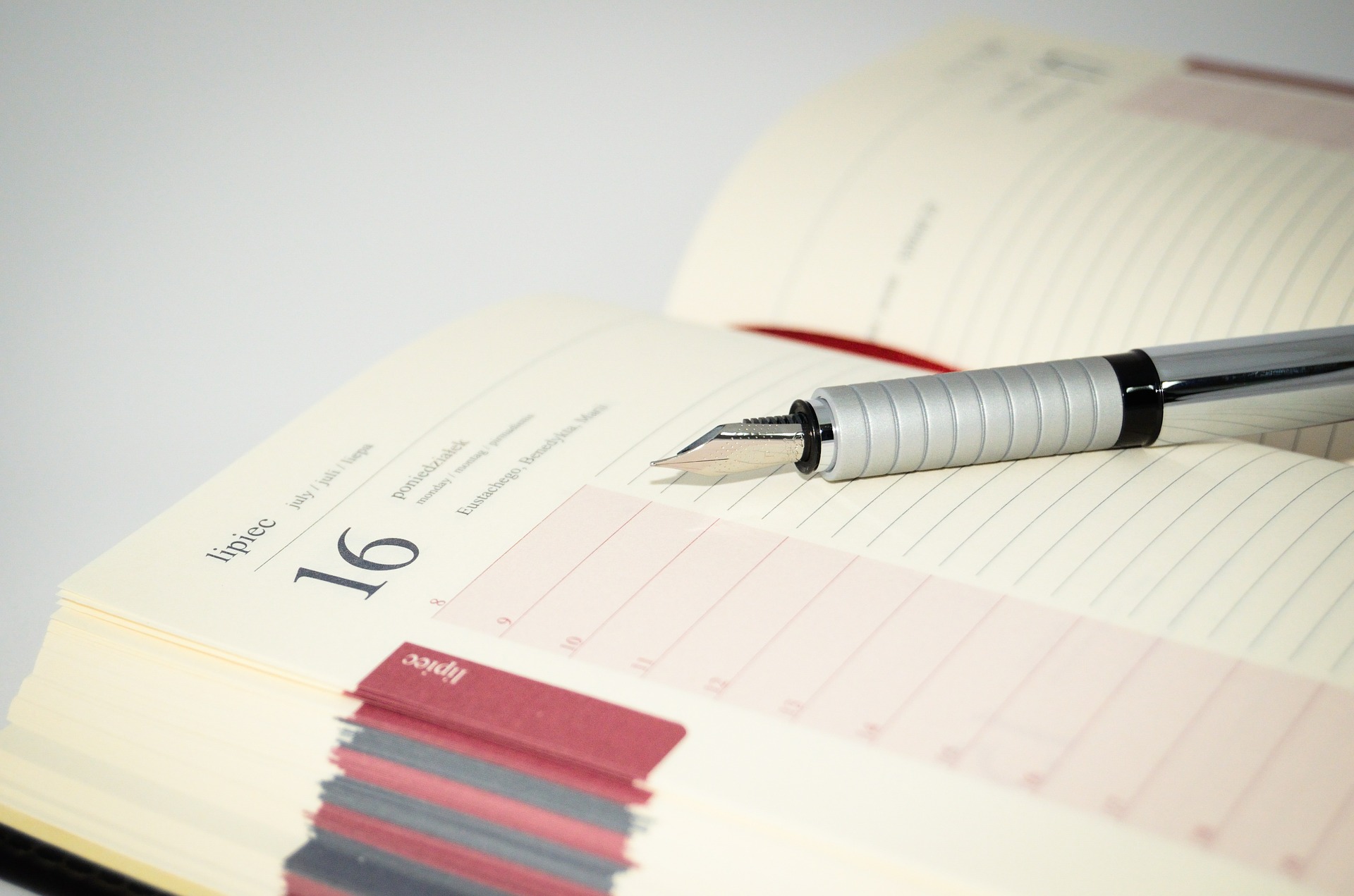Am Montag, dem 28. April 2025, wurde Spanien plötzlich mit einer der schwersten Störungen seines Stromnetzes konfrontiert, die es je erlebt hatte. Um genau zu sein, um 12:33 Uhr mittags fiel innerhalb von nur fünf Sekunden 60 % der gesamten nationalen Stromproduktion aus. Was folgte, war ein sogenannter „Black Start“, ein technischer Notfall, bei dem das gesamte System komplett neu gestartet werden musste, was alles andere als einfach ist.
Normalerweise arbeiten Kraftwerke in einem miteinander verbundenen System, in dem sie sich gegenseitig in ihrer Stabilität unterstützen. Bei einem Black Start ist dieses System jedoch ausgefallen, und bestimmte Kraftwerke müssen ohne jegliche Hilfe von außen selbstständig hochfahren. In Spanien sind dies vor allem Wasserkraftwerke wie Aldeadávila und La Muela, die dank ihrer Dieselgeneratoren als erste in Aktion treten konnten. Innerhalb von drei Minuten lieferten sie zusammen bereits 3 Gigawatt, was die Grundlage für den weiteren Neustart bildete.
Der Neustart musste nach einem sorgfältig koordinierten Plan erfolgen. Jedes Kraftwerk, das hochgefahren wurde, bildete vorübergehend eine „Insel“ mit einer stabilen Frequenz von 50 Hz. Diese Frequenz ist entscheidend: Wenn sie zu stark abweicht, können Generatoren beschädigt werden und es kann erneut zu einer Störung kommen. Deshalb wurde das System schrittweise wieder aufgebaut und erst dann mit anderen Teilen verbunden, als alles stabil lief. Die gesamte Operation wurde vom Centro de Control Eléctrico (CECOEL) von Red Eléctrica geleitet, das normalerweise nur „passiv“ das System überwacht, nun aber plötzlich die Rolle des aktiven Koordinators einer nationalen Energiekrise übernahm.
Auch Gaskraftwerke konnten relativ schnell wieder hochgefahren werden, aber Kernkraftwerke stellten ein größeres Problem dar. Fünf der sieben spanischen Kernreaktoren schalteten sich aufgrund des Stromausfalls automatisch ab und konnten nicht schnell wieder gestartet werden. Dies ist unter anderem auf die Entstehung von Xenon-135 zurückzuführen, einem Gas, das nach dem Abschalten entsteht und den Neustart der Kernspaltung vorübergehend verhindert. Im Fall des Kraftwerks Cofrentes beispielsweise dauerte es Stunden, bis der Gehalt dieses Gases so weit gesunken war, dass der Reaktor wieder sicher in Betrieb genommen werden konnte.
Darüber hinaus spielte auch der Zeitpunkt eine große Rolle bei der langsamen Wiederherstellung. Der Stromausfall begann mitten am Tag, aber die Sonne ging schon bald unter. Dadurch fiel die Solarenergieproduktion fast vollständig aus. Gleichzeitig gab es kaum Wind, sodass auch Windkraftanlagen nicht zur Wiederherstellung des Netzes beitragen konnten. Dies zeigt eine Schwachstelle eines Energiemixes, der zunehmend von den Wetterbedingungen abhängig ist.
Internationale Verbindungen boten zwar etwas Hilfe: Frankreich lieferte etwa 1,4 Gigawatt Notstrom, und auch Marokko schickte mehrere hundert Megawatt nach Spanien. Diese Hilfe war jedoch begrenzt, da auch diese Verbindungen nur funktionieren können, wenn die empfangende Seite selbst über eine minimale Grundversorgung verfügt.
Red Eléctrica räumte ein, dass das System nicht für einen vollständigen Stromausfall ausgelegt ist. In den letzten Jahren wurde viel in grüne Energie investiert, aber weniger in die für ein stabiles und widerstandsfähiges Netz erforderlichen Backup-Kapazitäten. Der Black Start vom 28. April war daher ein schmerzhafter Realitätscheck. Die Regierung hat inzwischen angekündigt, dass eine Bewertung der Reaktion auf die Krise und Maßnahmen zur Verbesserung der Zukunftssicherheit des Netzes folgen werden.
Quelle: Agenturen