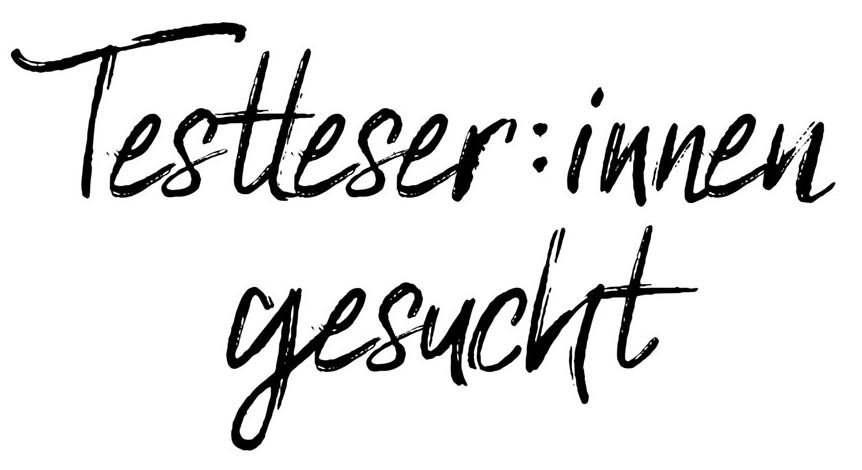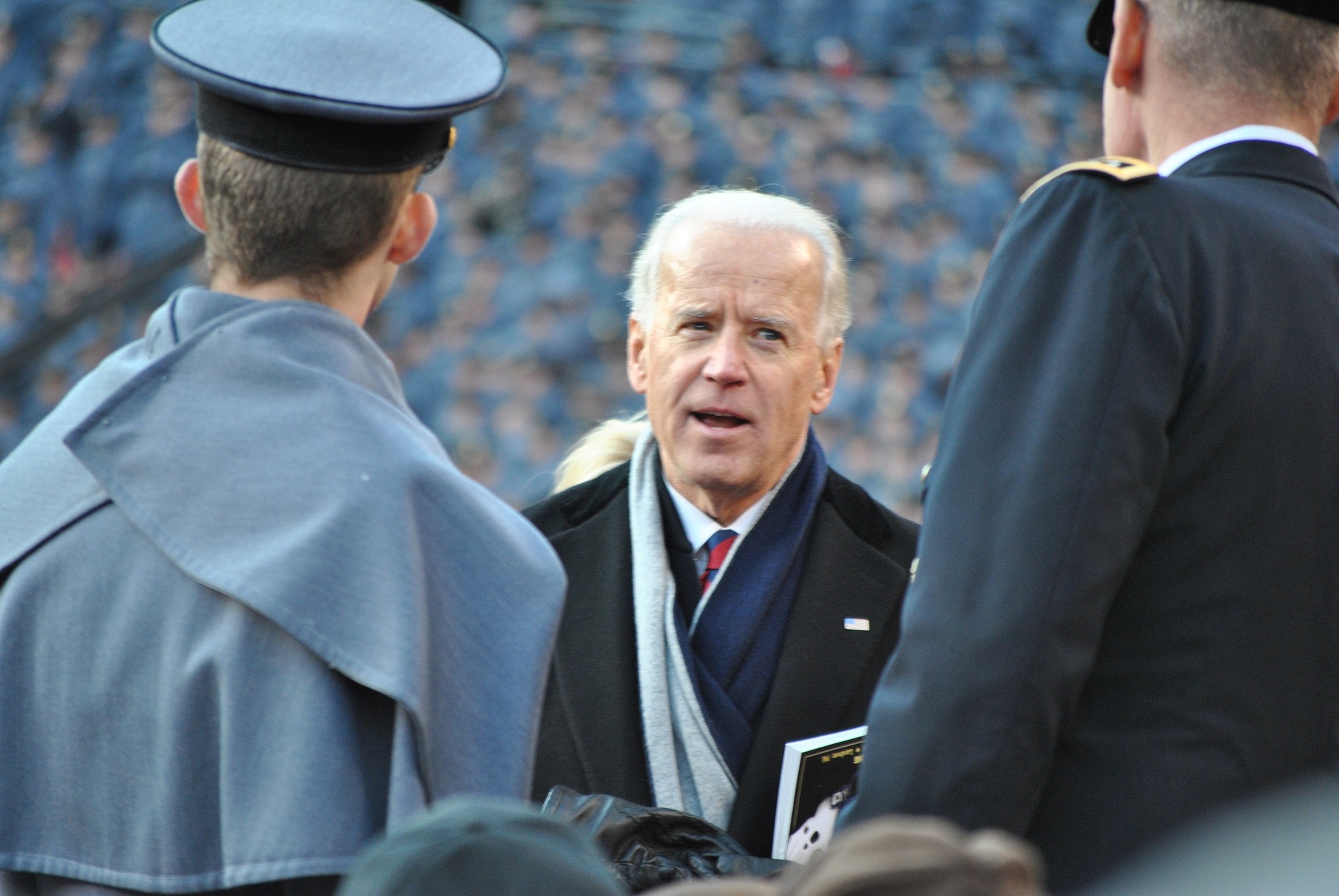Zu einer Zeit, in der bewaffnete Konflikte weltweit zunehmen, haben mehrere Länder Nord- und Mitteleuropas ihren Rückzug aus dem Übereinkommen über das Verbot von Minen antipersonell angekündigt, was bei internationalen humanitären Organisationen und Menschenrechtsexperten große Besorgnis ausgelöst hat. Diese Entscheidung, die mit der Verschlechterung der Sicherheitslage und angeblichen militärischen Bedrohungen begründet wird, stellt einen gefährlichen Rückschritt für den Schutz der Zivilbevölkerung dar.
Die Statistiken sind niederschmetternd: Mehr als 80 % der Opfer dieser tödlichen Waffen sind Zivilisten. In Spanien, wo bedeutende Kooperationsprogramme zur Beseitigung von Minen in betroffenen Ländern entwickelt wurden, hat diese Nachricht bei den humanitären Organisationen, die seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig sind, große Besorgnis ausgelöst.
Antipersonenminen haben verheerende Auswirkungen, die weit über das Ende der Konflikte hinaus andauern. Jüngsten Daten zufolge sind in etwa 60 Ländern noch immer mehr als 60 Millionen Minen vergraben, die etwa 15.000 Opfer pro Jahr fordern. Die Kosten für die Entschärfung einer Mine können bis zu 1.000 Euro betragen, während ihre Herstellung kaum mehr als 3 Euro kostet – ein Missverhältnis, das das Ausmaß des Problems widerspiegelt.
„Antipersonenminen unterscheiden nicht zwischen Soldaten und Kindern“, erklären Quellen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und betonen, dass die Auswirkungen dieser Waffen noch Jahrzehnte nach dem Ende der Konflikte fortbestehen.
Die Erfahrungen in Regionen wie dem Balkan, Afghanistan oder Kambodscha zeigen, dass Familien, die versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen, Kinder auf dem Schulweg und Bauern, die ihre Felder bestellen, noch viele Jahre nach der Rückkehr der Soldaten in ihre Heimat weiterhin in Lebensgefahr schweben oder verstümmelt werden können.
Das Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen, auch bekannt als Vertrag von Ottawa, wurde 1997 in dieser Stadt unterzeichnet und von 164 Ländern ratifiziert. De facto stellt es eine der größten Errungenschaften des zeitgenössischen humanitären Völkerrechts dar. Spanien trat dem Vertrag 1999 bei und schloss die Zerstörung seiner Arsenale 2008 ab. Damit positioniert es sich als entschiedener Verfechter des vollständigen Verbots dieser Waffen.
Experten weisen darauf hin, dass der militärische Nutzen dieser Waffen im Vergleich zu ihren verheerenden humanitären Auswirkungen äußerst begrenzt ist. „Unabhängig von ihrem taktischen Nutzen haben die Staaten beschlossen, sie zu verbieten, gerade weil einige Waffen unter keinen Umständen akzeptabel sind“, erklärt ein Sprecher der Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen, einer Organisation, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Vor kurzem haben die estnischen Behörden angekündigt, dass sie den Bau von etwa zwanzig Bunkern an der Grenze zu Russland planen. Die Pläne umfassen den Bau von Panzerabwehrbarrieren, Schießständen und sogar die Verlegung von Minen und Sprengstoff. Nicht umsonst haben die Esten zusammen mit ihren baltischen Partnern und Polen bereits die formellen Schritte eingeleitet, um aus dem Ottawa-Abkommen auszusteigen, das den Einsatz dieser Art von militärischen Elementen einschränkt.
Gefährliche Spirale: Wenn humanitäre Verpflichtungen aufgegeben werden
Für einige Ansichten bedeutet die Annahme humanitärer Normen in Friedenszeiten und deren spätere Aufgabe bei Spannungen oder Konflikten, dass ihr grundlegender Zweck völlig missverstanden wird. Noch besorgniserregender ist die Rechtfertigung, dass „der Gegner sie nicht respektiert“, was nach Ansicht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz eine gefährliche Abwärtsspirale bei den internationalen humanitären Standards auslösen könnte.
Ein spanischer Diplomat, der an den ursprünglichen Verhandlungen beteiligt war, sagte: „Ein Verzicht auf diese Verpflichtungen gefährdet nicht nur unschuldige Zivilisten, sondern schwächt auch das gesamte Gefüge des humanitären Völkerrechts, dessen Aufbau so viel Mühe gekostet hat.“
Während einige europäische Länder einen Rückzieher machen, hält Spanien an seiner Verpflichtung gegenüber dem Übereinkommen und den Programmen zur humanitären Minenräumung fest. Seit 1998 hat Spanien mehr als 70 000 000 Euro für Projekte zur Unterstützung von Minenopfern und zur Minenräumung in betroffenen Regionen wie Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten bereitgestellt.
Das spanische Außenministerium hat seine Position in einer Erklärung bekräftigt: „In diesen Zeiten internationaler Spannungen ist es wichtiger denn je, die humanitären Grundsätze zu verteidigen, die die Schwächsten in bewaffneten Konflikten schützen.“ Die aktuelle Krise macht nur die Anfälligkeit der Fortschritte im humanitären Völkerrecht deutlich.
Da sich mehr als 80 % der Staaten der Welt zu einer minenfreien Zukunft verpflichtet haben, steht die internationale Gemeinschaft vor einer Entscheidung: Entweder verstärkt sie das Stigma gegen Waffen mit inakzeptablen humanitären Auswirkungen oder sie lässt einen Rückschritt zu, der Tausende von zivilen Opfern kosten wird. Die Botschaft des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist klar: „Angesichts der vielen Kriege und der zunehmenden Spannungen müssen wir das humanitäre Völkerrecht und die Vision einer minenfreien Welt verteidigen.“
Quelle: Agenturen