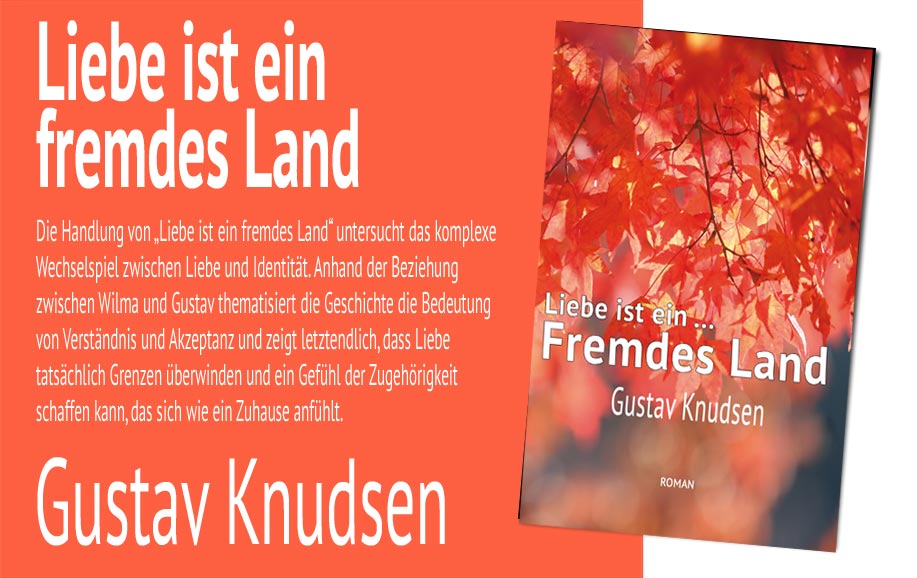Die Europäische Union hat kürzlich eine wichtige Entscheidung getroffen, die in der Welt des Naturschutzes für Aufsehen sorgte, obwohl Spanien dagegen gestimmt hat. Überraschenderweise hat die EU beschlossen, den Schutzstatus von Wölfen von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabzusetzen. Dieser Schritt hat sowohl positive als auch negative Reaktionen hervorgerufen. Er markiert ein neues Kapitel in der europäischen Naturpolitik und wird zweifelsohne große Auswirkungen auf die Zukunft dieser besonderen Tiere in Europa haben.
Die Rückkehr der Wölfe in weite Teile Europas ist eine der bemerkenswertesten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte im Naturschutz. Nach Jahren des intensiven Schutzes haben sich diese charismatischen Raubtiere in Gebieten wieder angesiedelt, in denen sie lange Zeit ausgerottet waren. Dieses Comeback wird von vielen als ökologischer Erfolg gewertet, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich.
Trotz der ökologischen Vorteile bringt die Rückkehr der Wölfe auch Spannungen mit sich, insbesondere in Gebieten, in denen Landwirtschaft und Viehzucht eine wichtige Rolle spielen. Viehzüchter befürchten mögliche Angriffe auf ihre Herden, was zu wirtschaftlichen Verlusten und emotionalem Stress führen kann.
Die jüngste Entscheidung der EU, den Schutz für Wölfe zu reduzieren, markiert eine wichtige Wende in der Wildtierpolitik. Diese Entscheidung hat sowohl Befürworter als auch Gegner und zeigt, welche Herausforderungen die Koexistenz mit Wölfen in unserem sich wandelnden Europa mit sich bringt. Die meisten Länder sprachen sich für diese Anpassung aus, aber Spanien und Irland waren dagegen, während Slowenien, Zypern, Malta und Belgien sich nicht äußerten.
Nach einer langen Debatte und wachsendem Druck hat die EU den Schutzstatus der Wölfe herabgesetzt. Die Europäische Kommission brachte den Vorschlag im Dezember 2023 auf den Weg und betonte, dass die veränderte Situation dies erforderlich mache.
Einer der Hauptgründe für die Änderung des Status ist die erfolgreiche Erholung der Wolfspopulationen in mehreren Teilen Europas. In einigen Gebieten sind die Bestände so stark angewachsen, dass es zu mehr Konflikten mit menschlichen Aktivitäten, insbesondere in der Landwirtschaft und der Tierhaltung, kommt.
Die Kommission ist der Ansicht, dass die Änderung des Schutzstatus ein wichtiger Schritt ist, um die durch die wachsende Wolfspopulation verursachten Probleme anzugehen. Dieser Prozess war recht kompliziert und bestand aus mehreren Phasen. Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission im Dezember 2023 gab es am 27. September 2024 eine wichtige Abstimmung unter den EU-Botschaftern.
Bei dieser Abstimmung stimmte die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten dem Vorschlag zu, den Schutzstatus des Wolfes von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabzusetzen. Dies geschah, obwohl einige Länder wie Spanien und Irland dagegen stimmten, während Slowenien, Zypern, Malta und Belgien sich der Stimme enthielten.
Diese Abstimmung ist jedoch nur ein Zwischenschritt. Der nächste Schritt ist die förmliche Genehmigung auf Ministerebene, nach der die Europäische Kommission die Initiative dem Ständigen Ausschuss der Berner Konvention vorlegen wird. Dieses internationale Forum wird letztendlich über die Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes entscheiden, sofern auf einer für Anfang Dezember anberaumten Sitzung die erforderliche Mehrheit erreicht wird.
Die Herabstufung des Schutzstatus von „streng geschützt“ auf „geschützt“ hat potenziell weitreichende Auswirkungen auf das Management der Wolfspopulationen in Europa. Der Wolf bleibt zwar weiterhin geschützt, doch bietet diese Änderung den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Behandlung wolfsbezogener Fragen.
Eine der wichtigsten Änderungen besteht darin, dass es unter dem neuen Status möglich sein könnte, Wölfe unter bestimmten Umständen zu jagen oder zu entnehmen. Dies könnte vor allem in Gebieten von Bedeutung sein, in denen Wölfe erhebliche Schäden an Nutztieren verursachen oder in denen die öffentliche Sicherheit gefährdet ist.
Die Entscheidung der EU hat bei den verschiedenen Interessengruppen unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Befürworter, darunter viele landwirtschaftliche Organisationen und einige Kommunalverwaltungen, begrüßen die Entscheidung als notwendigen Schritt zum besseren Schutz der Interessen von Viehzüchtern und lokalen Gemeinschaften.
Auf der anderen Seite hat die Entscheidung zu heftiger Kritik von Naturschutzorganisationen geführt. Mehr als 300 Organisationen der Zivilgesellschaft, darunter große Namen wie WWF, BirdLife und das Europäische Umweltbüro (EEB), hatten vor der Abstimmung ein Schreiben unterzeichnet, in dem sie sich für die Beibehaltung des strengen Schutzes der Wölfe aussprachen.
Diese Organisationen argumentieren, dass die Wolfspopulationen trotz der bemerkenswerten Erholung nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft noch weit von einem guten und lebensfähigen Zustand entfernt sind. Sie warnen, dass eine Herabsetzung des Schutzstatus die in den letzten Jahrzehnten erzielten Fortschritte gefährden könnte.
Quelle: Agenturen